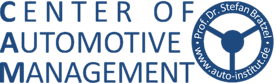Mai 14, 2024 | Presse
Bergisch Gladbach. Der schwache Absatz von Elektrofahrzeugen hat zum Jahresauftakt einer Studie zufolge auf die Gewinne der internationalen Autokonzerne gedrückt. Bei zehn ausgewählten Unternehmen fiel der Quartalsgewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) im Schnitt auf 7,1 Prozent des Umsatzes, wie das Forschungsinstitut Center of Automotive Management (CAM) in einer am Dienstag vorgelegten Studie zusammengetragen hat. In den drei Jahren zuvor hatte diese operative Marge durchschnittlich 8,3 bis 8,4 Prozent betragen. Pro Auto sank der durchschnittliche Gewinn (Ebit) um 19 Prozent auf 2253 Euro.
https://www.handelsblatt.com/mobilitaet/elektromobilitaet/mobilitaet-studie-e-autos-druecken-auf-gewinn-der-autohersteller/100037591.html
Apr 18, 2024 | Presse
“In Europe, EV sales are losing some of their momentum,” said CAM director Professor Stefan Bratzel. Long-term forecasts for EV sales in Europe are still very strong, with most expectations centering around 9 million a year in 2030, compared with about 2 million last year. PHEVs are still expected to remain the poor relation, hovering above and below 1 million sales a year through 2030.
https://www.forbes.com/sites/neilwinton/2024/04/16/plugin-hybrids-take-advantage-of-european-ev-pause-but-will-it-last/?ss=transportation&sh=f14b54f3041c
Apr 16, 2024 | Presse, E-Mobility
Deutschlands Autobauer halten sich immer noch für Weltspitze. Ein neues Ranking zeigt ziemlich deutlich: Der gute Ruf bröckelt mit der E-Wende.
…
Ein neues Ranking des Automotive-Forschungsinstituts CAM von Branchenexperte Stefan Bratzel stellt heraus, wie stark die Dominanz der Chinesen in der Elektrowelt wirklich ist. Die Zahlen liegen dem Handelsblatt exklusiv vor und dürften für Diskussionsstoff sorgen in einer Zeit, in der die Europäische Union kurz davor steht, Strafzölle auf den Import chinesischer Elektrofahrzeuge zu erheben.
https://www.handelsblatt.com/mobilitaet/elektromobilitaet/kein-deutsches-e-auto-in-der-welt-top-10-chinas-autobauer-werden-immer-innovativer/100031412.html
Dez 12, 2023 | Presse
„Wir brauchen einen Deutschlandpakt für die Automobilbranche“
Um wieder schneller, innovativer und produktiver zu werden, ist ein neues Mindset nötig, meint Stefan Bratzel. Der Professor schlägt fünf entscheidende Verbesserungen vor.
Deutschland möchte Leitanbieter und Leitmarkt der Elektromobilität werden. Doch davon sind wir weit entfernt. Was muss geschehen, um die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit des Automobilstandorts Deutschland zu sichern?
In wichtigen Zukunftsfeldern wie der Elektromobilität und dem software-definierten Fahrzeug sind viele internationale Wettbewerber schneller und besser als die deutschen Akteure – das gilt besonders für Tesla und einige chinesische Produzenten, allen voran BYD. Tesla und BYD führen das globale Absatzranking der Elektroautos mit Batterie (BEV) mit deutlichem Abstand an und sind Leitanbieter. China hat im vergangenen Jahr Deutschland als zweitgrößtes Auto-Exportland überholt und wird 2023 auch Japan überholen und zur Nummer eins aufzusteigen.
https://www.handelsblatt.com/meinung/gastbeitraege/wir-brauchen-einen-deutschlandpakt-fuer-die-automobilbranche/100002536.html
Dez 11, 2023 | Presse
CAM-Studie: Prognose der Beschäftigungsrückgänge in Deutschland infolge der Elektromobilität
https://www.ardmediathek.de/video/tagesthemen/tagesthemen-22-15-uhr-11-12-2023/das-erste/Y3JpZDovL3RhZ2Vzc2NoYXUuZGUvODA3NDhkMDYtZjlhOC00NGY1LWJjMTQtYWE4M2M2MzgzMjcwLVNFTkRVTkdTVklERU8
Dez 8, 2023 | Presse
Auch Automobilprofessor Stefan Bratzel schlägt Alarm: Die Hersteller in China seien „bei Innovation und Qualität mindestens auf Augenhöhe“. Deutsche Modelle seien oft nicht besser, „sondern nur teurer“. Die Innovationsstärke chinesischer Hersteller markiere „eine Zeitenwende in der globalen Automobilindustrie“.
„Während Chinas Entwicklungsabteilungen mitunter im Dreischichtbetrieb arbeiten, diskutieren wir in Deutschland die Viertagewoche.“
https://www.wiwo.de/my/unternehmen/auto/fuer-vw-und-co-wird-es-brutal-china-faehrt-uns-davon/29544448.html